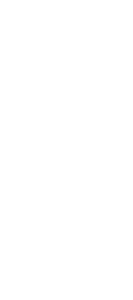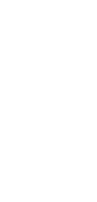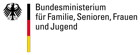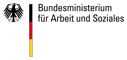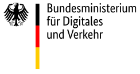Für Seeleute da in 33 Häfen weltweit – Deutsche Seemannsmission
Nachrichten und Berichte – Deutsche Seemannsmission und die Welt der Seeleute
-
Seit zweieinhalb Jahren in der Warteschleife
Seeleute brauchen Hilfe – Spendenaufruf Weggesperrt sein, warten und unendlich viel Geduld haben, mussten die Crewmitglieder des Schüttgutfrachters Trudy, der Ende Oktober 2021 vom französischen Zoll in Dünkirchen durchsucht wurde. An Bord des Schiffes hatten die Behörden daraufhin gut eine Tonne Kokain entdeckt. 19 der 20 Besatzungsmitglieder wurden von der französischen Nationalpolizei wegen Drogenschmuggels vorläufig … Weiterlesen …

-
Wanderausstellung Seafaring Tattoos in Le Havre
Le Havre. Die Foto-Wanderausstellung Seafaring Tattoos wandert aktuell durch Frankreich. Die nächste Station wird ab Donnerstag, 21. März das Gewerkschaftshaus in Le Havre (1, Rue Fontenoy 76600 Le Havre) sein. Mehr als zwei Jahre wurden Tattoos von Seeleuten fotografiert. Begleitend gab es Interviews, um den Geschichten hinter den Tätowierungen auf die Spur zu kommen. Entstanden … Weiterlesen …

-
Deutsche Seemannsmission und Havariekommando sind wichtige Kooperationspartner
Im Rahmen ihrer jährlichen Inlands-Mitarbeitenden-Konferenz haben die Deutsche Seemannsmission und das Havariekommando ihre enge Partnerschaft bekräftigt. An der dreitägigen Fachtagung in Cuxhaven nahmen rund 34 Mitarbeitende der Deutschen Seemannsmission aus ganz Norddeutschland teil. Sie bot Gelegenheit zum Austausch und Kennenlernen sowie zur Vertiefung des Verständnisses für die Arbeit des Havariekommandos. Über 40 Expertinnen und Experten … Weiterlesen …

-
Seemannsmission netzwerkt in der Natur und im Arbeitsalltag
Inlands-Mitarbeitenden-Konferenz in Cuxhaven Wer bei der Deutschen Seemannsmission arbeitet, muss gut netzwerken können und immer wieder neue Netzwerke knüpfen. Dr. Sabine Gravendyk-Schröder sprach bei der Inlands-Mitarbeitenden-Konferenz der Deutschen Seemannsmission vom 21. bis 23. Februar in Cuxhaven in einem Workshop über das sogenannte Natural networking. Biodiversität, Ökosysteme und deren Verbindungen zu Mensch und Tieren waren Thema. … Weiterlesen …

-
Seeleute seit drei Monaten als Geiseln
Deutsche Seemannsmission schließt sich internationalem Appell zur Freilassung der Seeleute der „Galaxy Leader“ an. Seit dem 19. November 2023 sind die 25 Besatzungsmitglieder der Galaxy Leader als Geiseln der Huthi im Jemen gefangen (Siehe auch Artikel zur Situation der Seeleute rund um das Rote Meer).Seeleute als Geiseln – das verstößt gegen internationales Recht.Zahlreiche Organisationen der … Weiterlesen …

-
Maritimer Beauftragter bei der Seemannsmission Altona
Dieter Janecek informiert sich über unsere Arbeit Dieter Janecek ist seit gut einem Jahr der Beauftragte der Bundesregierung für die Maritime Wirtschaft und Tourismus. Es gab schon mehrere Kontakte mit der Seemannsmission. Am 13. Februar war er zum Besuch bei der Deutschen Seemannsmission Hamburg Altona. Seemannsdiakon Fiete Sturm zeigte ihm das Haus. Er erklärte, dass … Weiterlesen …

Aktuelle Beiträge
- Seit zweieinhalb Jahren in der WarteschleifeSeeleute brauchen Hilfe – Spendenaufruf Weggesperrt sein, warten und unendlich viel … Weiterlesen …
- Wanderausstellung Seafaring Tattoos in Le HavreLe Havre. Die Foto-Wanderausstellung Seafaring Tattoos wandert aktuell durch Frankreich. Die … Weiterlesen …
- Deutsche Seemannsmission und Havariekommando sind wichtige KooperationspartnerIm Rahmen ihrer jährlichen Inlands-Mitarbeitenden-Konferenz haben die Deutsche Seemannsmission und das … Weiterlesen …
- Seemannsmission netzwerkt in der Natur und im ArbeitsalltagInlands-Mitarbeitenden-Konferenz in Cuxhaven Wer bei der Deutschen Seemannsmission arbeitet, muss gut … Weiterlesen …
- Seeleute seit drei Monaten als GeiselnDeutsche Seemannsmission schließt sich internationalem Appell zur Freilassung der Seeleute der … Weiterlesen …
- Maritimer Beauftragter bei der Seemannsmission AltonaDieter Janecek informiert sich über unsere Arbeit Dieter Janecek ist seit … Weiterlesen …
- Rotes Meer für Seeleute lebensgefährlich„Geiseln müssen freigelassen werden“Seemannsmission weist auf Situation der Seeleute hin Die … Weiterlesen …
- Stefanie Langos wechselt zur Deutschen SeemannsmissionMoin, ich bin Stefanie Langos, das neue Gesicht bei der Deutschen … Weiterlesen …
- Jahreslosung 2024: Liebevoll auf See und an LandGedanken zur Jahreslosung 2024 von Matthias Ristau Alles, was ihr tut, … Weiterlesen …
Gemeinsam engagiert – Vernetzung und Partnerschaften
-
Fotos von Seeleuten: eindrucksvolle Einblicke
Ausstellung mit Bildern, die Seeleute aufgenommen haben. Fotoausstellung „LIFE AT SEA“ Es ist noch nicht so lange her, als alle Geschäfts- und Lebensbereiche wegen des Ausbruchs der Covid-19-Pandemie weltweit stillgelegt wurden. Aber sie – die Seeleute – standen für uns da und versorgten uns weiterhin mit Waren. Ein philippinischer Seemann, der sein Foto mit dem … Weiterlesen …
-
Die Seemannsmission sucht Partner
Für unsere Arbeit brauchen wir Partner sowohl für einmalige und langfristige Projekt-Kooperationen. Sprechen Sie uns gerne an.

-
Kooperationen: Eine NGO mit Wirtschaft und Politik bestens vernetzt
Mit Generalsekretär Matthias Ristau (54) an der Spitze zieht die weltweite Deutsche Seemannsmission die großen Linien der NGO und ist mit Politik und Wirtschaft auf lokaler und Bundes-Ebene vernetzt, um sich für das Wohl der Seeleute einzusetzen.